Siedlungs- und Nutzungsgeschichte
Aus der Märkischen Schweiz sind vor- und frühgeschichtliche
Siedlungsspuren bekannt. Am Schermützelsee sind bronzezeitliche Pfahlbauten
belegt, seit 1255 ist die Stadt Buckow als "Villa buchowe" erwähnt.
Die Bezeichnung Buckow geht auf slawische Ursprünge zurück und
heißt "Buchen-Ort", was sich vegetationskundlich im Umfeld
erschließen läßt. Während des 30-jährigen Krieges
wurde die Umgebung im Zusammenhang mit dem Einfall der Schweden im Jahre
1637 in heftige Kämpfe verwickelt. Noch heute zeugen davon Wallanlagen
und Schanzen, z.B. die Schwedenschanze bei Waldsieversdorf. Der seit dem
14. Jahrhundert belegte blühende Hopfenanbau verlor seine ökonomisch
beherrschende Stellung, das Wappen der Stadt Buckow zeigt aber noch heute
eine Hopfenranke und eine Rose. Die Tuch- und Wollproduktion konnte keine
überregionale Bedeutung gewinnen, auch die 1782 begonnene Zucht von
Seidenraupen auf einer Maulbeerbaumplantage wurde Anfang des 19. Jahrhunderts
wieder aufgegeben. Einzig die Produktion von Arzneikräutern und die
Rosenzucht für die Gärten von Berlin und Potsdam waren wirtschaftlich
erfolgreich. An diese Tradition erinnern heute noch die zum Teil erhaltenen
Kletterrosenspaliere an das Häusern und das alljährliche "Buckower
Rosenfest" im Sommer. Als bezeichnend für die wirtschaftlich
ungünstigen natürlichen Standortvoraussetzungen der Märkischen
Schweiz kann die Einschätzung von BERGHAUS aus dem Jahre 1856 angesehen
werden: "Zu dem wirtschaftlichen Niedergange trug verschärfend
auch die von jedem Verkehr abgeschlossene Lage des Ortes bei. Die neuen
Kunststraßen (Chausseen) meiden das Buckower Erosionsgebiet. Sie
wurden nördlich und südlich daran vorbeigeführt ..."
(KRÜGEL, 1957, S. 56). Anfang des 19. Jahrhunderts gestaltete die
Gräfin von Friedland ihre Ländereien nach gartenkünstlerischen
Gesichtspunkten und führte eine regional angepaßte Landbewirtschaftung
ein. Die neuen Erkenntnisse des Landbaus entstammten der landwirtschaftlichen
Akademie von Albrecht Thaer in Möglin. Herausragende landschaftliche
Besonderheiten wurden, dem damaligen romantischen Naturempfinden entsprechend,
mit mystischen Begriffen z.B. Silberkehle, Teufelsbrücke, Wolfsschlucht,
Elysium belegt.
Bereits 1854 stellte der Leibarzt von König Wilhelm IV anläßlich
eines Besuches in Buckow fest: "Majestät, in Buckow geht die
Lunge auf Samt." Die verbesserten Verkehrsanbindungen an Berlin -
z.B. durch den Bau der Ostbahn nach Küstrin (1865) - begünstigten
den Fremdenverkehr. Die Berliner fuhren zur "Sommerfrische"
in die Märkische Schweiz. Aber auch Wintersport auf ausgebauten Rodelbahnen
in Buckow und in Bollersdorf war möglich. Regelmäßig wurde
ein "Märkischer Wintersporttag" veranstaltet. Die Buckower
Chronik von 1928 weist stolz auf den "nach Verbandsvorschrift"
errichteten Sprunghügel hin, der Skisprünge bis zu 20 m Weite
ermöglichte. Buckow stand Ende der 20-er Jahre mit 80.000 Übernachtungen
pro Saison an der Spitze der drei märkischen Luftkurorte (neben Bad
Freienwalde und Neuruppin). Kleine Hotels und Ferienhäuser prägten
das Ortsbild. Seit 1887 entstanden Landvillen auf dem Werder am Schermützelsee.
Die "Kurort-Architektur" der Jahrhundertwende ist heute ortsbildprägend
und fast völlig erhalten. Für Buckow bedeutende Persönlichkeiten
sind mit dem Namen Märkische Schweiz verbunden, Buckow war und ist
ein Ort zur Inspiration für viele Künstler. Schon Schriftsteller
wie Goethe, Eichendorf, Chamisso, Fontane ließen sich von der Landschaft
der Märkischen Schweiz verzaubern. Sie diente ihnen zur Erholung
und einem Leben im Einklang mit der Natur und war somit Inspiration für
viele ihrer Werke. Plätze wie die abgelegene Mühle am Stobber,
das Angelhäuschen am Griepensee, die Buckower Strandpromenade, der
Schermützelsee und viele mehr waren ihnen Orte der Entspannung, an
denen sie der Kunst nachgingen. Helene Weigel und Bertolt Brecht wählten
diese Umgebung um sich niederzulassen. In ihrem Haus am Schermützelsee
können heute Besucher die "Buckower Elegien" auf Kupfertafeln
und den originalen "Mutter-Courage-Wagen" bewundern, einem Konzert
oder einem Dichter lauschen.
Durch Brecht und Helene Weigel kamen schon damals berühmte Freunde
und Kollegen in die Märkische Schweiz. John Heartfield z.B. fand
sein Refugium am Großen Däbersee in Waldsieversdorf. Wolf Biermann
verfasst die "Buckower Balladen" auf diese einmalige Gegend.
Seit dem ersten "Klassik im Grünen" Open-Air im Buckower
Schlosspark im August 1991 kann man diese unverwechselbare Atmosphäre,
die schon früher die Künstler inspiriert hat, wieder spüren.
Eine ganze Reihe in dieser Zeit erschienener Reiseführer und Wanderkarten
beweisen die touristische Beliebtheit des Gebietes. Die alten Werbeanzeigen
künden von einer leistungsfähigen Gastronomie und einem gut
ausgebauten Transport- und Beherbergungsgewerbe. Aus dieser Zeit ist auch
das enge Netz von Wanderwegen belegt, das sich vornehmlich auf den inneren
Bereich des Buckower Kessels erstreckte. Touristische und kurörtliche
Entwicklung haben in den letzten 150 Jahren wesentlich die Identität
der gesamten Region geprägt. Nach 1990 ist der bedeutende - überwiegend
vom FDGB organisierte - Tourismus allerdings stark zurückgegangen.
Der Neuaufbau und die Neuorganisation sind bis heute nicht abgeschlossen.
Die umliegenden Gemeinden versuchen die Angebote des zentralen Bereiches
der märkischen Schweiz sinnvoll zu ergänzen bzw. zu erweitern,
um ebenfalls von touristischen bzw. kurörtlichen Entwicklungen zu
profitieren.
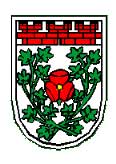
Stadtwappen von Buckow

Buckow

Albrecht Thaer

Wintersporttag